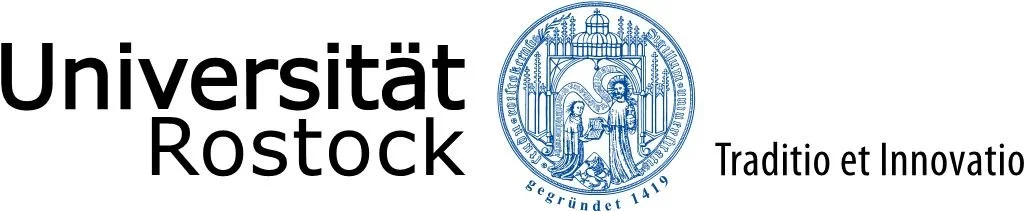Das Team
Die Projektpartner stellen sich vor:
ITPower Solutions GmbH
Projektkoordination
-
Seit mehr als 20 Jahren bietet ITPower Solutions Dienstleistungen und Softwarelösungen für die Entwicklung und Qualitätssicherung von Embedded Software.
Unsere Services umfassen die branchenübergreifende Beratung und operative Unterstützung entlang des gesamten Entwicklungsprozesses eingebetteter Software. Zusätzlich bieten wir unserem ContinoProva ein Tool für automatisiertes Testen von Embedded Software in einer heterogenen Toolumgebung. Aktiv ist das Unternehmen in den Branchen Automotive, Bahntechnik, Medizintechnik sowie im Bereich Industrieelektronik.
Darüber hinaus engagieren wir uns seit vielen Jahren in Forschung und Wissenschaft. Mit der Durchführung und Koordination von Forschungsprojekten erweitern wir unser Wissen, gestalten den wissenschaftlichen Diskurs mit und gewinnen wertvolle neue Erkenntnisse, die unsere Kompetenz als Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen fortlaufend stärkt. -
Dr. Sadegh Sadeghipour
-
Die Aufgabe von ITPower Solutions im Projekt ist die Entwicklung einer Simulation des medizinisch genutzten 5G-LiFi-Datentransfers für eine simulative Resilienzbewertung. Dabei soll das Kommunikationsverhalten des Netzwerkes mit all seinen medizinischen Geräten durch die Simulation so wiedergegeben werden, dass eine KI-basierte Erkennung von Anomalien, wie Störungen oder Cyberattacken, auf Grundlage der Simulation durchgeführt werden kann.
Brandenburgische Technische Universität
Projektpartner
-
Lehrstuhl IT-Sicherheit
Der Lehrstuhl betreibt Lehre und Forschung im Bereich IT-Sicherheit mit starkem Fokus auf Netzwerksicherheit und Schutz der Privatsphäre (Online Privacy). Der Lehrstuhl verfügt über langjährige Expertise in der Anwendung maschineller Lernverfahren zur Analyse des Netzwerkverkehrs sowie über Kompetenzen im Bereich des Schutzes der Privatsphäre und der Datensicherheit. Unser Ziel ist es, den Stand der Wissenschaft voranzutreiben und qualifizierte Informatiker für Industrie und Forschung auszubilden.
-
Prof. Dr.-Ing. Andriy Panchenko (Lehrstuhlleiter)
Artem Nazarenko, M.Sc. (Projektmitarbeiter)
Asya Mitseva, M.Sc. (Wissenschaftliche Mitarbeiterin)
-
Im Rahmen des Projektes haben wir das Ziel, neuartige Methoden zu entwickeln, die in der Lage sind, akkurat und effizient Anomalien bei Angriffen auf eine 5G-Infrastruktur zu erfassen, sowie den Grad der Offenlegung von sensiblen Patientendaten zu bewerten. Um dies zu erreichen, werden die anfallenden Datenströme erfasst und relevante Merkmale der Daten extrahiert. Aufbauend auf den hier gewonnenen Erkenntnissen, soll ein System entwickelt werden, welches durch Methoden des maschinellen Lernens in der Lage ist, das normale Verhalten eines Gerätes oder eines Netzwerksegmentes zu erkennen und zu reagieren, wenn sich Abweichungen von demselben zeigen.
Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut
Projektpartner
-
Innovationen für die digitale Gesellschaft von morgen stehen im Mittelpunkt der Forschungs- und Entwicklungsarbeit des Fraunhofer-Instituts für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut, HHI. Dabei ist das Fraunhofer HHI weltweit führend in der Erforschung von mobilen und optischen Kommunikationsnetzen und -systemen sowie der Kodierung von Videosignalen und Datenverarbeitung.
Gemeinsam mit internationalen Partnern aus Forschung und Industrie arbeitet das Fraunhofer HHI im gesamten Spektrum der digitalen Infrastruktur – von der grundlegenden Forschung bis hin zur Entwicklung von Prototypen und Lösungen. Das Institut trägt signifikant zu den Standards für Informations- und Kommunikationstechnologien bei und schafft neue Anwendungen als Partner der Industrie.Abteilung Photonische Netze
Die Abteilung Photonische Netze und Systeme entwickelt Lösungen für leistungsfähige optische Übertragungssysteme für den Einsatz in In-house-, Zugangs-, Metro-, Weitverkehrs- und Satellitenkommunikationsnetzen. Dabei stehen sowohl die Erhöhung der Kapazität als auch die Verbesserung der Sicherheit und der Energieeffizienz im Fokus der Forscher. Die Abteilung verfügt über die neueste Messtechnik, sehr gut ausgestattete Systemlabore, leistungsfähige Simulationswerkzeuge sowie die Möglichkeit zur Durchführung von Feldtests.
Forschungsgruppe Digitale Signalverarbeitung
Die Gruppe „Digitale Signalverarbeitung“ (DSP) forscht und entwickelt auf dem Gebiet der digitalen Signalverarbeitung in optischen Kommunikationssystemen. Sie adressiert die Entwicklung neuartiger Algorithmen von der ersten Idee bis zur Validierung in echtzeitfähigen digitalen Schaltungen. Die Expertise der DSP Gruppe umfasst alle Schritte vom Entwurf der Algorithmen in Matlab©/C++ über die Hardwarebeschreibung (z.B. in VHDL) bis zur FPGA-basierten Validierung in Echtzeit. Teile unserer Forschungsergebnisse sind als IP Cores verfügbar.
Forschungsgruppe Optische Metro-, Zugangs- und Inhausnetze
Die Gruppe "Optische Metro-, Zugangs- und Inhausnetze" (MAI) betreibt Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der drahtlosen und faserbasierten optischen Kommunikation für kurze Distanzen (< 100 km).
-
Dr. Dominic Schulz
Dr. Johannes Fischer
Elmar Schaff -
Die Aufgabe des Fraunhofer Heinrich-Hertz-Instituts besteht im Nachweis der Erhöhung der Sicherheit drahtloser Informationssysteme durch den Einsatz von Optical Wireless Communication Systems (auch als LiFi oder OWC bezeichnet) und deren Integration in eine 5G-Core Netz Referenz-Infrastruktur. Darüber hinaus soll eine sichere Datenübertragung zwischen Edge-Cloud Servern der Referenzarchitektur durch QKD-Technologien (Quantenverschlüsselung) gewährleistet werden. Die Funktionalität der entwickelten Lösungen soll in einem Projekt-Demonstrator gezeigt werden.
Universität Rostock
Projektpartner
-
Der Lehrstuhl Integrierte Systeme der Universität Rostock forscht unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Marc Reichenbach an energieeffizienten digitalen Systemen mit besonderem Fokus auf maschinelles Lernen. Im Kern der Forschung steht der Entwurf neuer Systeme mit dem Fokus auf einen Low-Energy-Footprint durch die Anwendung von apriori domänenspezifischem Wissen. Hierfür verfolgt die Forschergruppe einen Ansatz aus zwei Richtungen.
Neuartige Architekturen:
Moderne Rechensysteme sind oftmals nicht durch die Rechenleistung, sondern durch Speicherzugriffe beschränkt (Memory Wall). Effiziente Hardware-Systeme für Algorithmen müssen sich hiermit auseinander setzen. Der Lehrstuhl um Prof. Reichenbach befasst sich mit neuartigen Repräsentationen von Information, z.B. durch approximative Matrixzerlegungen zur Implementierung linearer Funktionen für höchsteffiziente Inferenz-Hardware für Neuronale Netzwerke, und mit neuartigen Speichertechnologien. High-Bandwidth-Memory (HBM) in Verbindung mit Near-Memory Computing profitiert von hochparallelen Speicherzugriffen während effiziente Speicherzuordnungen komplex werden. Nicht-flüchtige Speicherelemente, wie z.B. Resistive RAMs (RRAMs), ermöglichen analoges Rechnen im Speicher selbst. Die Forschergruppe erforscht diese neuartigen Technologien zur Implementierung effizienter Rechnersysteme.
Systemmodellierung:
Komplexes Systemdesign wird durch den Zielkonflikt zwischen Genauigkeit des Modells und Aussagekraft auf Systemebene ausgebremst. Die zielgerichtete Erkundung von Entwurfsräumen ist hierbei essentiell. Der Lehrstuhl für Integrierte Systeme beschäftigt sich mit der Überbrückung der semantischen Lücke zwischen Device-Level Eigenschaften und der Simulation auf Systemebene. So ist es möglich, bspw. die am realen Bauelement gemessenen und so statistisch modellierten Eigenschaften einzelner elektronischer Bauteile in eine Simulation auf Systemebene einfließen zu lassen, ohne dass die Berechnungskomplexität zur praktischen Unberechenbarkeit führt. So bilden die entwickelten Systemmodelle realitätsnahe Eigenschaften ab und eigenen sich dadurch für effiziente Entwurfsraumerprobungen.
-
-
Im Rahmen des Projekt medCS.5 beschäftigt sich der Lehrstuhl für Integrierte Systeme der Universität Rostock mit der Umsetzung effizienter Hardware-Architekturen zur Ausführung der Anomalieerkennung in Netzwerkdaten. Ein zentraler Aspekt des Entwurfsraum möglicher Implementierungen ist hierbei die Positionierung des Systems im Kommunikationsnetzwerk. Dabei gilt, je zentraler die Positionierung, desto mehr Rechenlast pro System und desto höher ist der Kommunikationsoverhead. Je mehr Systeme in Richtung der Edge des Kommunikationsnetzwerks wandern, desto wichtiger wird der Faktor der Energie. Das Forscherteam erforscht diesen Designraum für verschiedene Hardware-Architekturansätze, mit jeweiligen Optimierungen der angewandten neuronalen Netzwerke, sowie optimierter Vorverarbeitung der aufgenommenen Netzwerkdaten. Ziel des Teilprojekts ist die Umsetzung smarter Anomalieerkennungsknoten im 5G-Kommunikationsnetzwerk, welche bösartige Kommunikationsteilnehmer zuverlässig identifizieren.
ccc. Center for Connected Health Care UG
Unterauftragnehmer
-
Das ccc. Center for Connected Health Care UG ist 2016 als Spin-off des Verbundvorhabens »digilog« als Startup-Unternehmen und »unicorn« gegründet worden.
Ein Teil des ccc. ist das eHealth Hub, das Datenströme von »digitalen Begleitern«, gesundheitsbezogene Daten aus mobilen Anwendungen, empfängt, sammelt, interpretiert und daraus medizinisch handlungsrelevante Schlüsse für Betroffene und betreuende Ärzte und Institutionen formuliert.
Ferner agiert das ccc. als Ideenwerkstatt (Think-Tank) in Sonderforschungsbereichen wie derzeit für die Analyse und Sicherung des Zugangs zu Gesundheit in versorgungsprekären Regionen und hat umfangreiche Erfahrungen im Entwickeln und Durchführen von Forschungsprojekten gesammelt.
Das ccc. war im Jahr 2021 an mehreren klinischen Studien beteiligt und unterstützt Forschungseinrichtungen und Unternehmen bei der Planung und Durchführung von klinischen Studien. -
Prof. Dr. Dr. Kurt J. G. Schmailzl
-
Das ccc. Center for Connected Health Care UG führt im Arbeitspaket 1 eine Anforderungsanalyse durch. Unter dem Gesichtspunkt der Patient Journey in Praxis und Klinik wird eine Bedrohungsanalyse durchgeführt, werden kritische Punkte bei patientenbezogenen Daten aufgelistet und Rahmenbedingungen für die Nutzung eines 5G-Campusnetzes an klinischen Beispielen diskutiert. Im Arbeitspaket 6 werden Integrationstests von medizinischen Applikationen in einer 5G-Testumgebung durchgeführt. Hier wird ein Testfeld aus verschiedenen medizinischen Endgeräten (simulierte Praxis/Klinik) in einer 5G-Umgebung als Angriffsszenario mit aufgebaut, getestet und die Praktikabilität der gefundenen Lösungen aus Anwendersicht bewertet.